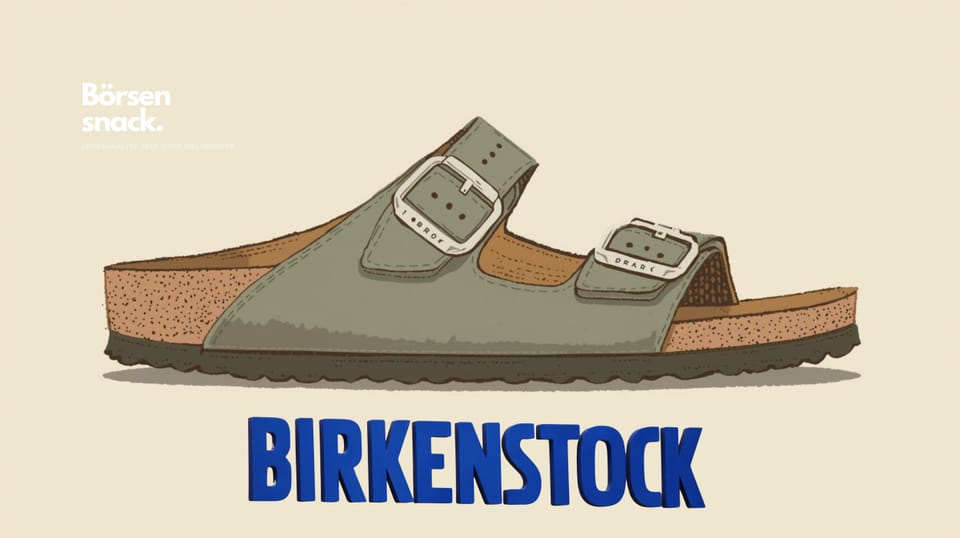Fair Value: Wie viel ist eine Aktie wirklich wert?
Fair Value: Warum der „faire Wert“ einer Aktie nur der Anfang ist – und wie du ihn wirklich nutzen kannst
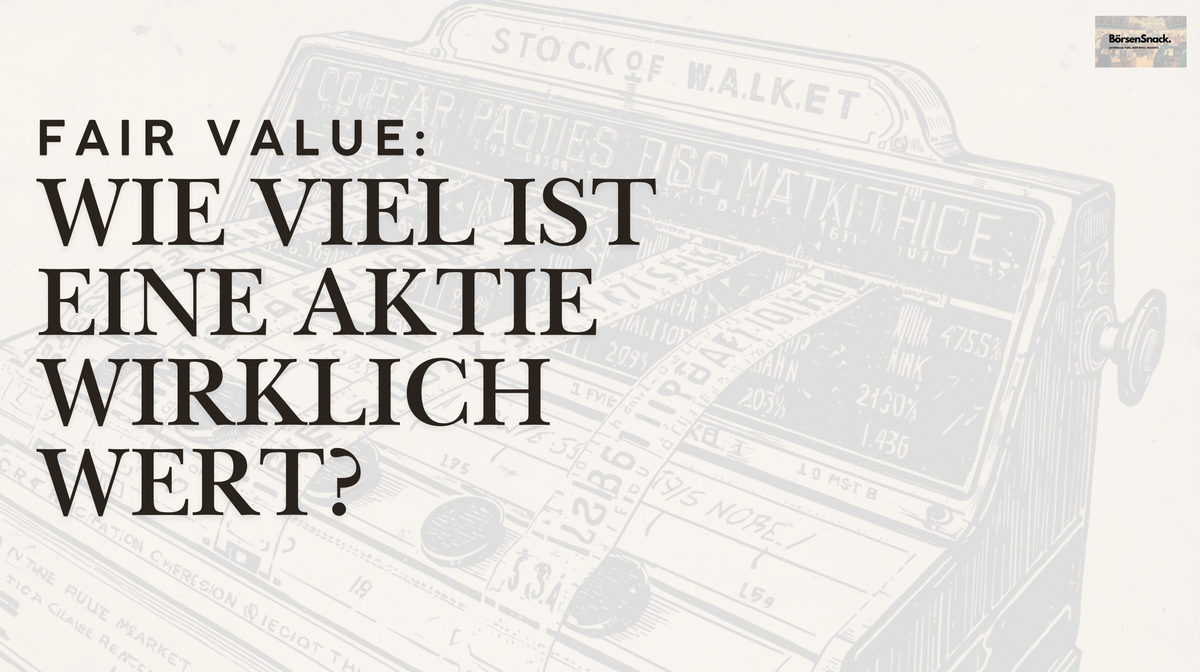
Der Begriff „Fair Value“ klingt nach Sicherheit. Eine Zahl, die angeblich verrät, ob eine Aktie gerade zu teuer oder günstig ist. Doch was hinter dem fairen Wert steckt, ist komplexer, als es auf den ersten Blick wirkt. Er ist zwar ein hilfreicher Orientierungspunkt, aber niemals die absolute Wahrheit. Wer ihn richtig versteht, kann klügere Entscheidungen treffen. Wer ihn überschätzt, läuft hingegen Gefahr, potentielle Chancen zu verpassen.
Der Blick in den Rückspiegel
Meist wird der Fair Value über historische Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) abgeleitet. Man schaut: Mit welchem KGV wurde das Unternehmen in den letzten Jahren im Schnitt bewertet? Liegt das heutige KGV darüber oder darunter?
Das ist ein einfacher und intuitiver Ansatz, aber im Kern nichts anderes als ein Blick in den Rückspiegel. Er zeigt, wie das Unternehmen historisch bewertet wurde. Die entscheidende Frage ist: Passt diese Perspektive noch zur Gegenwart und Zukunft?
Wenn es sinnvoll ist, über dem Fair Value zu kaufen
Viele machen den Fehler, alles über dem fairen Wert als „überteuert“ abzustempeln und dann nicht zu kaufen. Das kann fatal sein. Denn was passiert, wenn ein Unternehmen sein Geschäftsmodell weiterentwickelt, neue Märkte erschließt oder von einem Megatrend profitiert, wie zum Beispiel Alphabet vom KI Trend?
Dann passt der historische Fair Value schlicht nicht mehr. Die Zahlen ziehen erst später nach, wenn Gewinne steigen und Analysten ihre Schätzungen anpassen. Wer zu lange wartet, hat die spannendsten Kursanstiege oft schon verpasst.
Wie der Fair Value in der Finanzwelt definiert ist
In der Rechnungslegung hat der Begriff eine klare Bedeutung. Nach IFRS oder US-GAAP ist der Fair Value der geschätzte Marktwert eines Vermögenswerts oder einer Verbindlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt. also der Preis, den sachkundige, unabhängige Marktteilnehmer zahlen oder verlangen würden.
Das klingt trocken, ist aber entscheidend: Banken, Versicherungen und große Fonds müssen viele ihrer Finanzinstrumente (z. B. Derivate, Anleihen, Fondsanteile) regelmäßig zum Fair Value bewerten. Nur so bleibt die Bilanz nah am tatsächlichen Marktgeschehen.
Wo der Fair Value überall genutzt wird
- Bilanzierung: Bewertung von Finanzinstrumenten und Vermögenswerten nach Marktwert.
- Unternehmensbewertung: Schätzung des Werts bei Fusionen, Übernahmen oder Verkäufen.
- Immobilien & Assets: Bewertung von Sachwerten wie Immobilien oder Maschinen.
- Investitionsentscheidungen: Vergleich von fairem Wert und Marktpreis zur Einschätzung von Unter- oder Überbewertung.
- Regulierung: Aufsichtsbehörden nutzen Fair-Value-Bewertungen, um die Stabilität von Banken und Versicherern zu überwachen.
Methoden zur Berechnung des Fair Value
Es gibt nicht "die eine" Formel, denn verschiedene Methoden beleuchten unterschiedliche Facetten:
- Discounted Cash Flow (DCF): Prognose künftiger Cashflows, abgezinst auf den heutigen Wert
- KGV-Methode: Gewinn je Aktie × historisches oder branchenübliches KGV
- Dividenden-Discount-Modell (DDM): Besonders für Dividendenzahler – künftige Dividenden auf den heutigen Wert diskontieren
- Buchwert-Ansatz: Eigenkapital durch Anzahl der Aktien – nützlich in kapitalintensiven Branchen.
- Vergleichsanalyse (Multiples): Vergleich mit ähnlichen Unternehmen über KGV, KUV, KBV.
- Sum-of-the-Parts (SOTP): Bewertung von Konglomeraten, indem einzelne Geschäftsbereiche separat ermittelt und addiert werden.
Alle Methoden haben Vor- und Nachteile. Deshalb greifen Profis meist auf mehrere, verschiedene Verfahren zurück, um Verzerrungen zu vermeiden.
Wann Fair-Value-Berechnungen sinnvoll sind – und wann nicht
Besonders gut funktioniert der Fair Value bei stabilen Geschäftsmodellen wie Konsumgüterkonzernen, Versicherungen oder Versorgern. Hier lassen sich historische Bewertungsmuster zuverlässig fortschreiben.
Weniger nützlich ist er in dynamischen Branchen wie Tech oder Biotech. Dort ändern sich Rahmenbedingungen so schnell, dass historische Werte kaum Orientierung bieten.
Psychologie: Warum wir Fair Value so lieben
Der Fair Value reduziert die Komplexität auf eine einzige Zahl, und genau das macht ihn so verführerisch. Man bekommt das Gefühl, einen rationalen Anker zu besitzen. Doch die Börse ist keine Excel-Tabelle, sondern ein Spiel aus Erwartungen, Emotionen und Überraschungen. Wer nur auf den Fair Value starrt, verpasst oft die großen Geschichten: Innovation, Megatrends, Managementqualität, neue Märkte.
Meine persönliche Sicht
Für mich ist der Fair Value wie ein Thermometer. Er zeigt zwar die Temperatur, aber ob ich in den See springe, hängt von viel mehr ab: Wetterlage, Zeit, Lust.
Genauso bei Aktien: Der Fair Value sagt mir, ob etwas im historischen Vergleich teuer oder günstig wirkt. Aber die Entscheidung zu kaufen, treffe ich erst nach meiner umfassenden Analyse des Unternehmens, seiner Branche und seiner Zukunftsaussichten.